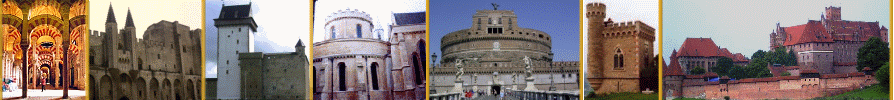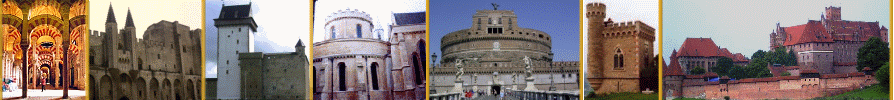|
|

|
 |
Zum
Jahresende 2013 entschloss sich timediver® zu einem Besuch der
Sonderausstellung "3300 BC Mysteriöse Steinzeittote und
ihre Welt", die vom vom 14. November 2013 bis zum
18. Mai 2014 währende im Landesmuseum
für Vorgeschichte in
Halle (Saale) exponiert wird. Da sich in diesem Museum mit der
"Himmelscheibe von Nebra" auch die älteste, bisher entdeckte
Himmelsdarstellung der ganzen Menschheitsgeschichte befindet, wurde
ich bei meinen Vorbereitungen auch auf die im Bundesland
Sachsen-Anhalt eingerichteten touristischen Route Himmelswege "
aufmerksam. Den knapp 400 Kilometer langen
Anfahrtsweg nach Halle nutzte ich daher, mich auf die touristische
Route Himmelswege zu
begeben und als erste Station die "
Arche
Nebra" zu besuchen (Foto
rechts).
|
 |
 |
.... nahe
des Fundortes der "Himmelsscheibe in der Gemarkung Ziegelroda, ca. 4
Kilometer westlich der Stadt Nebra zu besuchen. Anhand der Exponate und
eines phantastischen 3D-Films im Planetarium erfährt man dort
alles über die Herkunft und Anwendung der auf 4100 - 3700 v.
Chr. datierten Bronzescheibe, die 4. Juli 1999 von illegalen
Sondengängern (Raubgräbern) gefunden wurde. Rekonstruktionen
ergaben, dass die Scheibe in ihrer ersten Gestaltungsphase den
Vollmond, den zunehmenden Mond und oberhalb dazwischen die Plejaden
zeigte. In einem zweiten Schritt, bei dem einzelne Sterne versetzt,
bzw. überdeckt wurden erfolgte eine Ergänzung mit zwei
Horizontbogen, die an ihren Enden den Sonnenauf- und untergang
zum Winter- und Sommeranfang markieren. Dasselbe Prinzip liegt auch dem
Sonnenobservatorium von Goseck zugrunde.
|
 |
 |
In einem
dritten Arbeitsschritt wurde an der Unterkante noch ein Bogen
angebracht, der zwar keine astronomische Funktion besaß, analog
zu altägyptischen Darstellungen als "Sonnenbarke" gedeutet wird.
Das Foto links zeigt einen rekonstruierten Bronzerohling der Scheibe,
dem zwar die Goldteile fehelen, der jedoch an seinem Rand- wie das
Original - eine perforation vorweisen kann. Man nimmt an, dass diese
zur Zweckentfremdung der Scheibe als Standarte entstanden sind.
originelle und futuristische Präsentation bietet viele
Interaktionsmöglichkeiten und lustige Videoclips.
|

|
 |
Da ich
versehentlich "Burgstrasse" statt "Wartweg" in mein
Navigationsgerät eingeben hatte, kam ich von den Himmelswegen ab
zur Burg Querfurt (Foto links), auf deren Gelände mit Gräbern
der Aunjetitzer Kultur bereits frühbronzezeitliche
Artefakte gefunden wurden. Die 979 erstmals in einer Urkunde Kaiser
Ottos II. als Castrum erwähnte Burg sollte als Stammsitz der
Edelherren von Querfurt eine bewegte Geschichte erfahren, mit der ich
mich jedoch nicht näher befassen wollte, da auf mich am Rande des
Dorfes Langeneichstädt, einem Saalekreis in Ortsteil der
Stadt Mücheln im Geiseltal die zweite Station der "Himmelswege"
erwartete. Das dortige Megalith- oder Großsteinkammergrab
ist ca. 5500 Jahre alt...
|

|

|
Das 1987
bei Feldarbeiten gefundene, 5,3 m lange, 1,9 m breite und 1,7 m hohe
Artefakt ) wird auf den zeitraum zwischen 3600 bis 2700 v. Chr. datiert
und der Salzmünder Kultur oder der Bernburger Kultur zugerechnet.
Ale einer der Decksteine der Grabkammer wurde eine 1,76 m große
Menhirstatue entdeckt, die eine vereinfachte Darstellung einer
Göttin und als weibliche d ein Axtmotiv als Statussymbol des
Mannes zeigt. Die Berührung der mit der Erde verbundenen
"Dolmengöttin" (Ur- und Erdmutter) sollte Fruchtbarkeit für
Mensch, Tier und Felder gewährleisten. Der heute im Hallenser
Museum ausgestellte Original-Menhir weist daher Abtragungsspuren
auf. Der aufgestellte Stein ist eine Kopie (Foto rechts).
|
 |
 |
Mein
dritte Station auf den "Himmelswegen", das der Porta Nigra in Trier
nachempfundene Museumsgebäude des Landesmuseum für Vorgeschichte
beherbergt seit seiner
Wiedereröffnung am 23. Mai 2008 neue Dauerausstellungen zum
Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum und zur
Frühbronzezeit, die Ende 2012 um die Epochen der Mittel- und
Spätbronzezeit sowie der Frühen Eisenzeit erweitert wurden.
Während die Räume der Präsenzausstellung das 2. und 1.
Obergeschoss des Museums einnehmen, wurde die Sonderausstellung auf der
0-Ebene eingerichtet. Das nicht nur für die Sonderausstellung,
sondern im gesamten Museumsbereich geltende striktes Fotografierverbot
wird von einer Vielzahl uniformierter Aufpassern durchgesetzt.
timediver® musste daher auf ein eigenes Foto der "Himmelsscheibe
von Nebra" verzichten und bedient sich hier einer Abbildung aus
wikipedia.
|
| Nachdem
ich meinen Museumsbesuch abgeschlossen hatte, setzte bereits
die Abenddämmerung ein, die mich jedoch nicht von einem kurzen
Stammbummel abhalten konnte. Da jedoch die Lichtverhältnisse zum
Fotografieren nicht mehr optimal waren, setzte ich meine
Besichtigungstour am nächsten Vormittag in aller Frühe fort,
was an den
Bilden mit dem blauen Himmel zu erkennen ist. |
 |
 |
 |
| Der
Mitte des 15. Jahrhunderts neben dem 1819 abgerissenen Galgentor
errichtete, 44 Meter hohe Leipziger
Turm (Foto links) war der höchste Turm der „hallensischen“
Stadtbefestigungsanlage. Das ursprünglich als „runder Turm"
bezeichnete, aus Bruchsteinen gemauerte Bauwerk besitzt eine untere
Mauerstärke von 2,80 Metern und einen Innenraumdurchmesser von
3,30 Metern. Die spitzbogige Eingangstür auf der Stadtseite und
die Fenster in den Stockwerken sind gotischen Ursprungs und gut
erhalten. 1573 wurde dem Turm im Stil der Renaissance eine welsche
Haube mit vier Lukarnen und einer Laterne aufgesetzt. Das Uhrwerk mit
zwei Zifferblättern wurde später eingebaut. Das Denkmal des
in Halle geborenen Barock-Komponisten Georg Friedrich Händel (1685
– 1759) wurde anlässlich seines 100. Todestages im Jahre 1859 auf
dem Marktplatz errichtet. Von seinem erhabenen Standort aus blickt das
das 3,20 Meter hohe Bronzestandbild gen England, die zweite Heimat
Händels, wo er in der Londoner Westminster Abbey seine letzte
Ruhestätte gefunden hatte. Das Denkmal zeigt ihn, sich mit
dem Taktstock in der rechten Hand auf das Dirigentenpult stützend,
auf dem die aufgeschlagenen Notenblätter des "Messias" liegen. Die
Marktkirche Unser Lieben Frauen (Foto rechts) .... |
|
 |
 |
....entstand
zwischen 1529 und 1554 auf dem
Terrain ihrer Vorgängerinnen St. Gertruden und St. Marien als
jüngste
der mittelalterlichen Kirchen der Stadt und zählt zu den
bedeutendsten
Bauten der Spätgotik in Mitteldeutschland. Ihre vier Türme
bilden
zusammen mit dem Roten Turm (Foto Mitte) das Wahrzeichen der
Saalestadt, die daher
auch als „Stadt der fünf
Türme“ bezeichnet wird. Das
Gotteshaus ist insofern ein Kuriosum, da es als auch protestantische
Kirche noch ein Marienaltarbild beherbergt und auch als Marienkirche
bezeichnet wird. Unmittelbar neben dem Alten
Rathaus, das am 31. März 1945 einem Bombenangriff der Alliierten
zu Opfer fallen sollte, wurde in den Jahren 1928/29 an der Ostseite des
Marktplatzes auf einer derzeit unbebauten Fläche, vor dem 1928/29
der auch als Neues Rathaus bezeichnete Ratshof
(Foto rechts) errichtet.
|
 |
 |
 |
|
Der auf dem
Marktplatz errichtete Rote Turm
(Foto links) steht beinahe genau im
Zentrum der Stadt. Im pätgotischen Stil erbaut, weist der
freistehende Uhr- und Glockenturm eine rechteckige Grundfläche von
etwa 10 mal 15 Meter auf. Mit seiner Höhe von 140 alte Hallischen
Ellen oder 268 1/2 rheinländischen Fuß (84 Metern) war der
mit „246 Stacheln“ und einem vergoldeten Kugelknauf von 3,60 Meter
Umfang auf seinem kupfernen Helmdach verzierte Turm, das höchste
mittelalterliche Bauwerk der Stadt. Zunächst als Neuer Turm
bezeichnet, wurde das Bauwerk wahrscheinlich aufgrund der an seinem
seinem Fuße abgehaltenen Blutgerichte in Roter Turm umbenannt.
Ausdruck der Blutgerichtsbarkeit war die 1547 unmittelbar am Turm
aufgestellte Roland-Figur
(Foto Mitte). Im Rahmen des Marktplatzumbaus
bis 2006 wurde von der Stadt ein
Geoskop (Foto rechst) geschaffen.
Der Edelstahlkasten über einer mehreren Meter tiefen
Schachtung erlaubt einen Blick auf den unterirdischen Verlauf der
Halleschen
Marktplatzverwerfung. Die Halle-Störung
oder Hallesche
Störung kommt aufgrund der speziellen geologischen
Situation, die
sie im Stadtgebiet geschaffen hatte, mit der Entstehung von Solequellen
eine entscheidende Bedeutung zu. Mit dem Gutjahr- und Meteritzbrunen,
dem Hackeborn sowie Deutscher Born befinden sich die vier
ältesten, historisch belegbaren Solebrunnen im heutigen
Stadtzentrum in der Nähe der Verwerfung. Die Salzgewinnung in den
Salinen war im Mittelalter, als das Salz mit Gold aufgewogen wurde, von
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und sollte zurückgehend auf
das „germanische“ oder „keltisches“ Wort für Salz (hal, halla) der
Stadt ihren Namen geben.
|
|
 |
 |
Der 3,50
hohe Drachenbrunnen wurde vom
halleschen Landschaftsmaler und Bildhauer Peter Michael entworfen und
1983 vor dem Westportal der Marktkirche errichtet (Foto links). Das
zwischen 1889 - 1981 errichtete Archäologische Museum der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beherbergt seit 1928
die altertumswissenschaftlichen Disziplinen der Universität und
wird nach dem in Halle geborenen Philologen Archäologen und
Professor Carl Robert (1850- 1922 in Halle an der Saale) auch kurz Robertinum genannt. (Foto
rechts).
|
 |
 |
|
Das zwischen 1903 bis
1905 im Stil des
wilhelminischen Neobarock erbaute Landgerichtsgebäude
vereint in
sich auch Formen der Gotik, der Renaissance und des Jugendstils. Als
eines der repräsentativsten Bauwerke der Stadt besitzt es eine
breite Doppelturmfassade zum Hansering, die unter anderem mit
Porträts von Rechtsgelehrten und an den Fenstersimsen mit Tieren
und
Fabelwesen geschmückt ist. Die flankierenden Türme haben eine
Höhe
von 50 Metern. Nach einer umfangreichen Restaurierung
wurde das Justizgebäude im Frühjahr 2013 wieder
eröffnet.
|
 |
 |
|
Das Gebäude der Hauptpost (Foto links) wurde als
als neuromanischer Sandsteinbau für die Oberpostdirektion zwischen
1892 bis 1898 als gründer- zeitlicher Monumentalbau an einer
städtebaulich exponierten Stelle errichtet. Anlass für den
Bau, der
das 1840 erbaute preußische Generalpostamt ersetzte, war die
Gründung der Deutschen Reichspost 1875 und die Ausweitung ihrer
Tätigkeit auf das Telegrafen- und Fernsprechwesen. Im die
Schalterhalle im Erdgeschoss wurde für die Briefpost, das erste
Obergeschoss von der Oberpostdirektion und das zweite Obergeschoss
vom Telegrafen -amt genutzt. 1912 erhielt das Gebäude einen
Erweiterungsbau für die Paketpost mit zugehörigen
Funktionsräumen. Im 1886 eröffneten Stadttheater befindet
sich heute die Oper Halle. Zur
Zeit seiner Eröffnung war das Stadttheater neben der Budapester
Oper das technisch gesehen modernste Theater Europas. Beim Wiederaufbau
des bei einem Sprengbombenangriff am 31. März 1945 fast
völlig zerstörten Gebäudes, wurde auf die frühere
Kubatur, Fassade, Kuppel und kleinere Details verzichtet. 1951 wieder
eingeweiht, wurde es als Staatstheater des Bezirks Halle im Land
Sachsen-Anhalt und Mehrspartentheater Landestheater Halle, dann bis 1992 Theater des Friedens genannt. Heute
(Foto rechts) bietet das Haus
für alle Sparten und Gattungen des Musiktheaters insgesamt
über 672 Sitzplätze, die sich auch behindertengerecht
über Parkett, 1. und 2. Rang verteilen.
|
 |
 |
| Da es mir
mit dem Blauton der Fotos zu bunt wurde, schaltete ich ein wenig an den
Einstellung meiner Kamera herum, was sie mir schließlich mit
farblich besseren Fotos danken sollte. Am dem heute als Alter Markt bezeichneten Platz,stand
das erste hallesche Rathaus mit der heute nicht mehr vorhandenen
Michaeliskapelle, die erste Pfarrkirche der Stadt. Der Baukern
der heutigen Hausnummern 7 und 8 stammt aus dem späten 12.,
bzw. frühen 13. Jahrhundert und beherbergte im 16. Jahrhundert den
Gasthof „Zu den drei Kronen“. In der Platzmitte steht heute der
1913 aufgestellte Eselsbrunnen
der an eine bekannte hallesche Sage erinnern soll. Nach einer
Komplettsanierung des Hauses Alter Markt 12, dem 1708 errichteten
Wohnhaus des vermögenden Pfänners Karl-Heinrich Reichhelm
(1650−1724), wurde dort am 8. April 2000 dasBeatles Museum in Halle (Foto rechts)
eröffnet, dessen Besuch sich timediver® auch als eher den
Rolling Stones zugewandter Musikfreund sich nicht entgehen lassen
wollte. |
 |
 |
| Bereits
1964 begann der Museumsgründer Rainer
Moers damit alles zu sammeln, was er von und über die
Beatles bekommen konnte. Ab 1975 stellte er seine Sammlung für
eine Wanderausstellung zu Verfügung, welche in ca. 25 Städten
im In- und Ausland zu sehen exponiert wurde 1989 ließ er sich mit
seinem Sammelsurium in Köln, auf knapp
60 m² Fläche nieder. Nachdem das Beatles Museum in
Köln am 31. Juli 1999 geschlossen worden war, konnte es ein halbes
Jahr später in Halle, der selbsternannten Landeskulturhaupstadt
Sachsen-Anhalts neu eröffnet werden. Neben Rainer Moers zeichnete
sich hierbei der im Oktober 2000 verstorbene Matthias
Bühring als Museumsgründer aus. |
 |

|
Auf drei
Etagen und einer Ausstellungfläche von etwa 600 qm werden
insgesamt 2.500 Exponate ausgestellt. Das Museum finanziert sich
größtenteils aus durch einen Versandhandels mit
Beatles-Produkten, die auch im Foyer-Shop des Museums erhältlich
sind (Foto links). Videoclip 1
|
 |
 |
 |
| Raum
1
ist der "Vor-Beatles-Zeit" gewidmet, wo auch das Kinderfoto von John
Winston Lennon ( 9.10.1940 in Liverpool - 8.12.1980 in New York) zu
sehen ist (Foto links). Lennon und seine zweite Frau Yoko Ono und
Lennon im Film "Wie ich den Krieg gewann (Foto rechts). |
|
 |
 |
Raum 2,
The Beatles von 1957-1964, beherbergt Dokumente von der
ersten Begegnung zwischen John Lennon und Paul McCartney sowie deren
Auftritte als Quarrymen, zu denen später auch George Harrisson
hinzukam. Ein altes TV-Gerät zeigt Filme von ersten Auftritten der
Gruppe. (Foto links).
Der
Damenstrumpf mit den Beatles-Motiven befindet sich im
sogenannten "Blauen Raum" (Raum
3), The Beatles von 1965 bis 1966
|

|
 |
Besondere
Raritäten sind die veröffentlichten und vor allem die beiden unveröffentlichten Beatles-Singles aus
der DDR, über die in Things Nr. 73, dem Clubheft des
Beatles Museums berichtet wurde. Leider ist mein Foto von den
beiden Weißmustern aus dem Jahre 1965, der geplanten vierten und fünften
Beatles-Single: „I Wanna Hold Your Hand / Little Child“ (Amiga
Sp. U 291/292) und „A Hard Day’s Night / Please Mr. Postman“
(Amiga Sp. U 293/294) unscharf geworden (Foto links). Die Wand eines Seitengangs ist
dem deutschen Muasiker und Grafiker Klaus Voormann (Jg. 1938)
gewidmet, welcher das Cover der LP Revolver gestaltete und
auf Soloalben von John Lennon, George Harrison und Ringo Starr als
Bassist zu hören ist.
Voormann wurde und wird oftmals auch als fünfter Beatle bezeichnet.
|
 |
 |
Der Blaumiese (Blue
Meanie) und andere Merchandisingprodukte finden sich in Raum 8, der
anlässlich der Wiederveröffentlichung des Kultfilms Yellow Submarine (1999) eingerichtet
wurde (Foto links). Raum 4: The Beatles von 1967 bis 1968 ist
dem Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band (Foto rechts), dem Tod des Managers Brian Epstein, der
Magical Mystery Tour sowie dem Indien-Trip
mit dem Besuch von Maharishi Mahesh
Yogi gewidmet.
|

|

|
Die Moritzburg wurde
zwischen 1484 - 1503 im pätgotischen Stil als
Residenz der Magdeburger Erzbischöfe erbaut und ist heute eines
der imposantesten Bauwerke der Saalestadt. Seit dem 19. Jahrhundert
beherbergt ein Kunstmuseum mit überregionaler Ausstrahlung. Der
Grundriss bildet ein fast regelmäßiges Viereck von etwa 72
mal 85 Metern. Süd-, Ost- und Nordseite werden von einem 20 bis 25
Meter breiten und 10 Meter tiefen, in früherer zeit sumpfigen
Grabenumgeben. Der Eingangsturm
in der Mitte der Ostseite (Foto links)
diente einst als ein Wohnturm, der eine Kapelle im untersten Geschoss
besaß. Die Maria-Magdalenen-Kapelle
und der Nordostturm, der auch Studentenclub-Turm
genannt wird (Foto rechts).
|

|

|
Auf dem Jerusalemplatz wurde eine
Gedenkstätte für die 1938 von den Nazis niedergebrannte
Synagoge errichtet. Eine angebrachte Tafel erinnert an die
jüdischen Opfer, die dem NS-Terror zwischen 1933 bis 1945 zum
Opfer gefallen sind und mahnt die Lebenden: Vergesst nicht!
|

|
 |
Die heutige Synagoge der etwa 700
Mitglieder zählenden jüdischen Gemeinde wurde 1894
ursprünglich als Feierhalle, neben dem bereits 1864 angelegten
jüdischen Friedhof in der Humboldtstraße. Der
schlichte Saalbau im
maurischen Stil besitzt große Rundbogenfenster und fünf
Türme. Nach einigen Umbauarbeiten wurde
das Gebäude 1953 als Ersatz für die während der
Novemberpogrome 1938 zerstörte Synagoge in der Innenstadt geweiht.
Wenige Meter von der neuen Synagoge entfernt, steht der zwischen 1897 -
1999 im Zuge einer Stadterweiterung nach Norden aus rotem Werkstein und
gelben Klinkern errichtete Wasserturm
(Foto rechts). Der Hochbehälter hatte ein Fassungsvermögen
von 1500 Kubikmetern und verlor seine Funktion erst nach der
Inbetriebnahme des Fernwassernetzes zwischen dem Ostharz und der Elbaue
im Jahre 1965. Das markante, unter Denkmalschutz stehende Bauwerk wurde
zwischen 1992 bis 1999 saniert.
|

|

|
Auf
meinem Rückweg besuchte timediver® mit der Kreisgrabenanlage von Goseck
(Burgenlandkreis) die vierte und letzte Station der Himmelswege.
Nachdem 1991 bei einem Erkundungsflug vom
Luftbildarchäologen Otto Braasch ringförmige
Bodenverfärbungen entdeckt und als neues Bodendenkmal gemeldet
worden waren, wurde die Anlage zwischen 2002 und 2004 im Rahmen eines
interdisziplinären Forschungsprojektes vollständig
ausgegraben. Zwischen Juni bis Oktober 2005 konnte auf dem mittlerweile
vollständig freigelegten Areal das steinzeitliche
Sonnenobservatorium rekonstruiert werden. Die Eröffnung fand am
21. Dezember 2005 am Tag der Wintersonnenwende statt. Die
ursprüngliche, vor etwa 6900 Jahren errichtete Anlage wird der
Kultur der Stichbandkeramik zugeordnet und von einigen Archäologen
als das älteste Sonnenobservatorium der Welt bezeichnet.
|

|

|
Die
Kreisgrabenanlage liegt auf einem Plateau oberhalb des Saaletals und
besteht aus einem deutlich erkennbaren, annähernd kreisrunden
Ringgraben von etwa 71 m Durchmesser. Es konnte ein flacher Erdwall
rund um den Graben nachgewiesen werden. Die Anlage hat drei
grabengesäumte Zugangswege, die nach Norden, Südwesten und
Südosten ausgerichtet sind. Im Inneren befinden sich Spuren zweier
konzentrischer Palisaden (ca. 56 und 49 m Durchmesser) mit gleich
ausgerichteten, zum Zentrum hin schmaler werdenden Toren.
|
 |

|
Nach
Untersuchungen des Astroarchäologen Prof. Dr. Wolfhard Schlosser
vom Astronomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, sind die
beiden südlichen Tore und Zugangswege vom Mittelpunkt der Anlage
aus gesehen mit einer Genauigkeit von drei bis vier Tagen auf den
Sonnenaufgang und -untergang zur Wintersonnenwende um 4800 v. Chr.
ausgerichtet, das nördliche Tor weist annähernd genau auf den
astronomischen Meridian, also nach Norden. Dass es sich um ein
Observatorium zur Bestimmung der Wintersonnenwende handelt, gilt daher
als wahrscheinlich.
|
 |

|
Die erste
Naumburger Dom St. Peter und Paul wurde
zwischen 1029 -1044, nachdem die Erlaubnis zur Verlegung des
Bischofssitzes von Zeitz nach Naumburg erteilt worden war, als
dreischiffige, kreuzförmige Basilika erbaut.
|

|

|
Der
Eingang zum Dom befindet sich zwischen der Marienpfarrkirche und der
Dreikönigskapelle, rechts davon steht der Ekkehard-Brunnen
(Foto links). Das Portal zum südlichen Längsschiff an der
Nordseite des Doms (Foto rechts).
|

|

|
Vom
Langhaus des Domes gelangt der Besucher durch den aufwendig gestalteten
Lettner (Foto links) in den Westchor (Foto rechts), dessen Baubeginn
1245/50 datiert wird. Dort befinden sich die zwölf
Naumburger Stifterfiguren, die zu den bedeutendsten deutschen
Skulpturen des Mittelalters gehören. Die polychromen Skulpturen
aus Grillenburger Sandstein wurden um 1250 durch den so genannten
Naumburger Meister geschaffen. Jeweils zwei Figuren stehen an der Nord-
und Südwand, zwei Figurenpaare am Eingang der Apsis und jeweils
eine Figur an den vier Innenstreben des 5/8 Polygons (Foto re.).
|

|

|

|
Markgraf Ekkehard II. und Uta (Foto
links), Graf Wilhelm von Camburg und
Brehna (Foto Mitte) und Markgraf
Hermann und Reglindis (Foto rechts). Die historischen
realen Personen waren zur Entstehungszeit der Skulpturen bereits seit
200 Jahren verstorben. Als individuell charakterisierte
Persönlich- keiten stellen die Figuren die Formvollendung einer
naturalistischer Darstellung dar, die im deutschsprachigen Raum um 1200
die einfachere schemen- haften abglöst hatte. Aufgrund der
Baugeschichte des Naumburger Domes bisher noch nicht festgestellt
werden, welche Statuen zuerst und welche zuletzt geschaffen wurden.
|

|

|

|
Markgräfin Uta von Ballenstedt (um
1000 - 1046; Foto links), die Gattin des Markgrafen Ekkehard II. von
Meißen, war eine Tochter von Graf Adalbert von Ballenstedt und
Hidda, der Tochter des Markgrafen Hodo I. der sächsischen Mark
Lausitz. Die Schwester des Stammvaters der Askanier, Esico von
Ballenstedt wurde von ihrem Vater wohl aus machtpolitischen
Gründen um das Jahr 1026 mit dem Meißner Markgrafen Ekkehard
II. verheiratet. Die kinderlose Ehe bedeutete das Ende des von Ekkehard
I. (985–1002) gegründeten Geschlechts der Ekkehardiner. Graf Dietmar (Foto Mitte). Markgräfin Reglindis (um 989
-1016, Foto rechts) war eine Tochter des polnischen Königs
Bolesław I. Chrobry und der sorbischen Fürstentochter Emnilda.
1002 wurde die "lächelnde Polin", wie sie auch genannt wird, mit
Markgraf Hermann verheiratet, dem Sohn Ekkehards I. und älteren
Bruders Ekkehards II. von Meißen. Nach der Ermordung Ekkehards I.
und nach der Belehnung Bolesławs mit den Lausitzen festigte die Ehe
(trotz der Kriege des ostfränkischen Königs und
römisch-deutschen Kaisers Heinrichs II. gegen Polen) die
Beziehungen zwischen den Piasten und Ekkehardinern.
|
|
 |
 |
Die
spätromanische Ostapsis
wurde 1330 durch ein hochgotisches, rechteckiges Chorjoch mit einem
6/10-Schluss ersetzt. Auf den
Strebepfeilern am Chorscheitel und südlich daneben wurden die bis
heute
mehrfach restaurierten Figuren der
Patrone des Domes aufgestellt. Von hohem künstlerischem Wert sind
die
zum Teil noch aus der Bauzeit des
Chores stammenden Glasmalereien mit den klugen und törichten
Jungfrauen
sowie den Tugenden und Propheten. Aus dem ersten Drittel des 15.
Jahrhudnerts stammen hingegen die Fenster mit den Abbildungen der
Passion, Aposteln un die Marienszenen. Der um 1230 errichtete
Ost-Lettner ist das älteste erhaltene Beispiel eines
Hallenlettners (Foto links). Im mittleren Joch der Lettnerhalle steht
ein Marienaltar aus dem
19. Jahrhundert (Foto rechts).
|
 |

|
Im
Ostchor befindet sich die poychrome und gut erhaltene Grabplatte des Bischofs Dietrich II. von
Meißen (um 1190 -1272), der von 1242 bis 1272 als Bischof
von Naumburg amtiert hatte (Foto links). Zu Füßen der
Bischofsskulptur führen zwei steile Treppen zum Chor hinauf (Foto
rechts).
|
 |
 |
Unter dem
Ostchor des ersten frühromanischen Doms (Foto links) wurde
zwischen 1170 und 1180 eine zweite
Krypta eingebaut. Die ausgedehnte Anlage der Krypta besteht aus
einem Vorraum aus der Bauzeit des Doms (Foto rechts)...
|
 |
 |
....einem
Mittelteil, der schon im frühromanischen Dom als Krypta diente,
und einer abschließenden östlichen Apsis. Als ältester
Raum, besteht der mittlere aus drei Schiffen zu je drei Jochen und ist
über sechs Freisäulen und acht Wandstützen
kreuzgratgewölbt. Jeder Säulenschaft ist mit einem anderen
Muster dekoriert. Meisterwerke sind auch die Säulenkapitelle,
welche den typischen romanischen Palmettendekor mit Diamantbändern
zeigen. (Foto links).
|
 |
 |
Der
Spätromanischer Kreuzgang
an der Südseite (Foto links). Die beiden Fragmente aus dem Relief
an der Nordseite des
Westlettners (Foto rechts) markieren den Eingang zum Kellergewölbe
unter der
Westklausur, welche am 1. Juli 2006 als Naumburger Domschatzkammer
eröffnet wurde. Sie beherbergt einmalige Kunst- und
Kulturschätze aus
sechs Jahrhunderten.....
|

|

|
... wie
beispielsweise das aus der Grablegung des Bischofs Dietrich II. von
Meißen stammende, aus Elfenbein gefertigte obere Endstück des Bischofsstabes (Foto
links) und die Wahlkapitulation
August des Starken vom 31. Mai 1726 (1670 -1733; Foto rechts).
Der aus der albertinischen Linie der Wettiner stammende Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen regierte ab 1697 auch in
Personalunion als König August
II Mocny von Polen und Großfürst
Augustas II
Stiprusis von Litauen.
|

|

|

|
Der
Kreuzgang mit den beiden Westtürmen (Foto links) und den jeweils
mit einer Barockhaube gekrönten Osttürmen (Foto
rechts). Das Gemälde aus der Domschatzkammer stammt von Lucas Cranach dem Älteren (um
1472 - 1553), der ab 1505 als Hofmaler am
kursächsischen Hof als Hofmaler unter den Kurfürsten
Friedrich dem Weisen, Johann dem Beständigen und Johann Friedrich
dem Großmütigen in Diensten stand und zu den
bedeutendsten deutschen Maler und Grafiker der Renaissance gehört.
Naumburg liegt an der Straße
der Romanik", die als touristische Route durch die
Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen verläuft und
ein Teil der Transromanica darstellt, die im Jahr 2006 vom Europarat
zur Europäischen Kulturstraße ernannt wurde (Foto rechts).
|
|
timediver®'s
andere Fotoseiten Sachsen-Anhalt
|
|
|
|
timediver®'s
Rezensionen und Empfehlungen
|
|
|