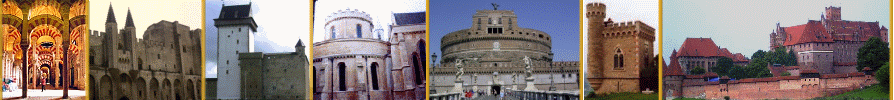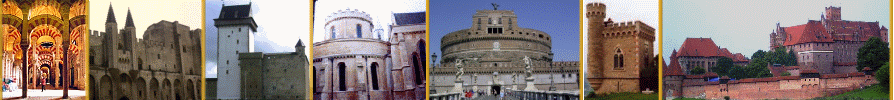|
Anlässlich
der Niedersächsische Landesausstellung 2013 „Roms vergessener
Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn", die vom 1. September 2013
bis zum 19. Januar 2014 im Braunschweigischen Landesmuseum
stattfindet, hat sich timediver® nach 1996 ein zweites Mal in die
Stadt Heinrichs des Löwen begeben. Da ich damals versäumt
hatte,
Fotos zu machen, wollte ich dies gleichzeitig nachholen.
|

|
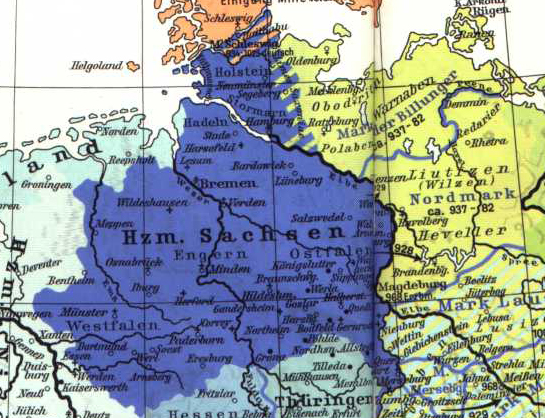
|
|
Die erste Siedlung auf
dem Gebiet der
heutigen Stadt Braunschweig würde gemäß der
Braunschweigischen
Reimchronik 861 gegründet. worden sein. Experten halten diese
Quelle jedoch für eine reine Legende, vielmehr gilt mit der
Weiheurkunde der Magnikirche 1031 als erster urkundlicher Nachweis.
Herrscher Braunschweigs waren seit dem 10. Jahrhundert die Nachfahren
Brunos, dem sagenhaften Gründer der Stadt, die daher als Brunonen
bezeichnet wurden. Über Richenza von Northeim, der Nichte des Brunonen Ekbert
II., und deren Tochter Gertrud von Süpplingenburg
ging die Stadt Braunschweig und das gesamte Herzogtum Sachsen 1142 in
den Besitz Heinrichs des Löwen
über, der damit sein erstes
Herzogtum erlangen konnte (Karte rechts). 1156 konnte Heinrich dann
auch die Herzogswürde für Bayern erlangen. Die
Bauarbeiten an der zur Ehre von
Sankt Blasius’ und Sankt Johannes dem Täufer gestifteten
Kollegiatskirche („Braunschweiger Dom“; Foto links) begannen im Jahre
1173
nach der Rückkehr Heinrichs des Löwen von einer Pilgerreise
aus dem
Heiligen Land. Während der ersten Verbannung Heinrichs nach
England
(1182–1185 wurden die Bauarbeiten unterbrochen.
|

|

|

|
|
Das
nördliche Seitenschiff mit seinen
gedrehten Säulen wurde im „Perpendicular Style“ errichtet (Foto
links). Der bronzene Siebenarmige Leuchter aus dem 12.
Jahrhundert gehört zu den wertvollsten Ausstattungsstücken
des
Gotteshauses (Foto Mitte). Er besteht aus 74 Einzelteilen, hat eine
Höhe von 4,80
m, eine Spannweite von 4,30 m und wiegt über 400 kg.
DasMittelschiff
in Blickrichtung Osten (Foto rechts).
|
|

|

|
| Das
Modell zeigt einen Querschnitt durch
die
Stiftskirche (Foto links). Die Secco-Malereien in der Vierung (Foto
rechts) zeigen
das Himmlische Jerusalem. Sie sind zwischen 1230 und 1250 entstanden
und wurden 1845 unter einer Übermalung wiederentdeckt, abgepaust
und
restauriert. Heute sind zwar noch etwa 80 % der Malereien erhalten,
allerdings ist zu bedenken..... |

|
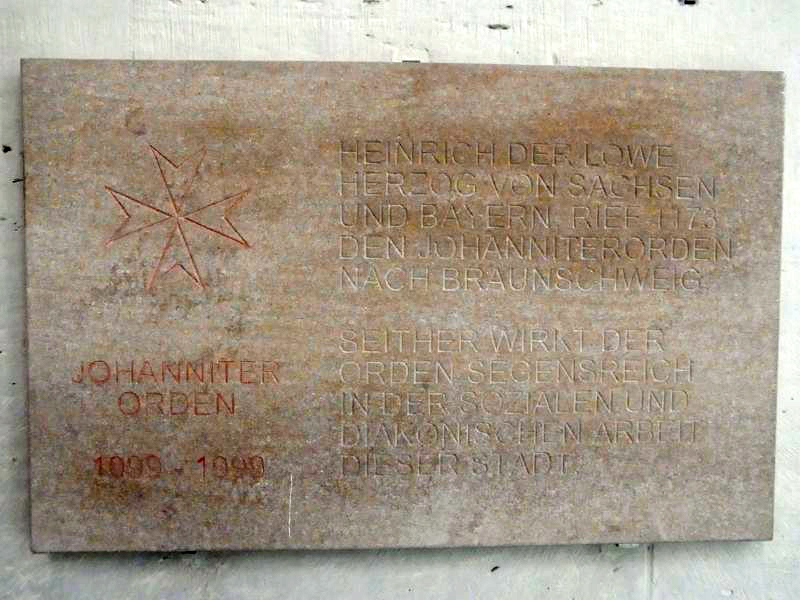 |
.....dass
es im Stil des Historismus im 19.
Jahrhundert durchaus üblich war, phantasievolle Ergänzungen
einzubringen welche nichts mit dem Original zu tun hatten. Die
Gedenktafel erinnert daran, dass Heinrich der Löwe den im Jahre
1099 gegründeten Johanniterorden nach
Braunschweig holte.
|
|
|
|
Im Mittelschiff steht
das Epitaph für
das Grabmal für Heinrich den Löwen und seine zweite Ehefrau
Mathilde Plantagenet, einer Schwester des englischen Königs
Richard
II., genannt Löwinherz (Foto Mitte). Die Stiftskirche wurde
bereits
seit 14. oder 15. Jahrhundert als Dom bezeichnet, gleichwohl sie kein
Bischofssitz war.
|
 |
 |
| Vom
westlichen Querschiff
gelangt man unterhalb des hohen Chors in die romanische Unterkirche
des Doms (Foto links). Der ursprüngliche Zugang an der Seite des
Kreuzaltars im
Langschiff wurde nach 1687 an die jetzige Stelle verlegt. Die
Unterkirche ist der älteste Bauteil des Braunschweiger Doms und
beherbergt heute die "Welfen-Gruft" mit Angehörigen des
Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg (1692–1814), des
Herzogtum
Braunschweig (1814–1918) und des Königreiches Hannover
(1814–1866). |

|

|
Die
Krypta besteht aus zwei Teilräumen und abschließender Apsis.
Sie
erstreckt sich als dreischiffige Hallenkrypta unter der Vierung und
dem Hohen Chor. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in dem
neunjochigen Raum die vier Säulen unter der Vierung, die die
Stützfunktion übernehmen. Drei der Säulenschäfte
aus Sandstein
sollen aus dem Vorgängerbau des Doms, der Stiftskirche der
Brunonen,
übernommen worden sein (Foto links).
Foto links; von
links nach rechts: Ferdinand
(1721-1792), Preußischer Feldmarschall,
Sieger von Krefeld und Minden. - Friedrich
Wilhelm (1771-1815),
Schwarzer Herzog. Herzog von Öls, verheiratet mit Marie
Prinzessin von
Baden, gefallen bei Quatrebras (Waterloo) - Karl
Wilhelm Ferdinand
(1735-1806), Vater des Schw.
Herzogs,
verh. mit Prinz.
Augusta von England, gest. in Ottensen
bei Hamburg an der bei Auerstedt erlittenen Wunde. |

|

|
| Foto
links:
Eleonore Charlotte (1686-1748), Tochter des Herzogs Kasimir von
Curland (13) verheiratet mit Ernst Ferdinand (1682-1746), Propst von
St.Blasii und St.Cyriaci (14). Foto
rechts: Wilhelm
(Karl Maximilian Friedrich) (1806-1884), Sohn des Schwarzen Herzogs
Friedrich Wilhelm (7)-
Karoline Amalie Elisabeth (1768-1821), Schwester des Schwarzen
Herzogs (8), verheiratet mit König
Georg IV. von England (1762 - 1830) - Albrecht
(1725-1745), gefallen als preußischer Generalmajor in der
Schlacht
bei Soor (9). |

|

|
|
Foto
links: Ludwig Ernst (1718-1788), Reichsgeneralfeldmarschall,
General-Kapitän der Niederlande (15) - Friedrich Franz
(1732-1758),
gefallen als preußischer Generalmajor bei dem Überfall bei
Hochkirch (16). Foto
rechts: Heinrich Ferdinand (1684-1706), gefallen als Oberleutnant
von Turin (5) - August Ferdinand (1677-1704), gefallen als
Generalmajor im Treffen am Schellenberg bei Donauwörth (6).
|

|

|
| Foto
links: Ferdinand Christian (1682-1706), Propst von St.Blasii und
St.Cyriaci (3) - Friedrich Georg (1723-1766), Domherr in Lübeck
(4).
Foto rechts: Christine (1648-1702), Tochter des Landgrafen Friedrich
von Hessen-Eschwege (1) und ihr Gatte Ferdinand Albrecht I.
(1636-1687), residierte von 1667-1687 in Bevern (2). |

|

|
|
Foto
links: Leopold (1752-1785), preußischer Generalmajor, ertrunken
in Frankfurt a.d.O. bei dem Versuch, Menschen zu retten (17) -
Philippine Charlotte (1716-1801), Schwester Friedrichs des Großen
(18) , verheiratet mit Karl I (1713-1780)., regierte ab 1735 (19).
Foto rechts: Ferdinand Albrecht II. (1680-1735), kaiserlicher
Generalfeldzeugmeister und Reichsfeldmarschall, regierte ab 1735
(20), verheiratet mit Antoinette-Amalie (1696-1762), jüngste
Tochter (21) von Herzog Ludwig Rudolf.
|

|

|
|
An der Westseite der
Welfen-Gruft
führen einige Stufen in die tiefer gelegene Gruft Heinrich des
Löwen (Linker Sarkophag im Foto unten links), seiner zweiten
Gattin Mathilde (rechter Sarkophag) und einiger Brunonen (dahinter
quergestellt). Mit den von Hitler persönlich ausgewählten
Architekten
Walter und Johannes Krüger wurden die Erbauer des Ehrenmals
und der
Hindenburg-Gruft bei Tannenberg mit dem Entwurf einer neuen Gruft
für
Heinrich den Löwen beauftragt. Über dem Eingang wurde als
Schlussstein des Gewölbes ein stilisierter Löwenkopf des von
den
Nationalsozialisten bevorzugten Bildhauers Arno Breker eingesetzt
(Foto rechts).
|

|

|
|
Die Bauarbeiten an der
wuchtigen,
beinahe quadratischen Gruft aus Odenwälder Granit dauerten von
1936
und bis 1938. Gleichzeitig wurde der Dom zu einer
"Nationalsozialistischen Kultstätte" umgebaut. Sowohl die
Ausgrabungs- und Renovierungsarbeiten in der Gruft, als auch genaue
Zuordnung der vorgefundenen Skelette sind bis heute fragwürdig
geblieben. Der NS-Staat verlor jedoch bald das Interesse an Heinrich
dem
Löwen. Einerseits weil sich der "Reichsführer SS"
Heinrich Himmler als "Reinkarnation" von König Heinrich I.
(um 876 - 936) betrachtete und sich dessen Gruft im Quedlinburger Dom
zuwandte. Andererseits eignete sich der ostfränkische König
und
seine nach Osten gerichtete Kolonialpolitik besser als "Vorbild"
für den Eroberungskrieg der Nazis, als Heinrich der Löwe, der
zudem
gegen seinen Cousin, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, opponierte und
von diesem deshalb im Jahre 1180 die Herzogtümer Sachsen und
Bayern
entzogen bekam.
|

|
 |
|
An den vier Seiten der
neuen Grablege
befinden sich je paarweise angeordnet die Wappen der von Heinrich dem
Löwen gegründeten Städte München, Lübeck und Lüneburg, sowie
seiner Residenz Braunschweig.
In einer Art „Reliquiennische“
waren bis 1945 unter anderem zwei Schaufassungen mit einer
vermeintlichen Haarlocke Heinrichs und einem im angeblichen Grab
Mathildes vorgefundenen Gewebeband ausgestellt. 1946 wurde der
vermeintliche Sarkophag Heinrichs des Löwen letztmalig
geöffnet, um Haarlocken wieder zurückzulegen.
|

|

|
Schon im
11. Jahrhundert hatten die Brunonen auf einer natürlichen
Okerinsel eine Befestigung errichtet, die erstmals 1134 als „Castrum
Tanquarderoth“ urkundlich wird. Zwischen 1160 bis 1175 wurde an
dieser Stelle die Burg Dankwarderode als Pfalz für Herzog Heinrich
den Löwen erbaut (Foto links). In Anlehnung an die Kaiserpfalz
Goslar wurde das Hauptgebäude als doppelgeschossiger Palas
mit
Doppelkapelle angelegt. Es bestand ein direkter Zugang vom
Obergeschoss in das Nordquerhaus der seit 1173 im Bau befindlichen
Stiftskirche. Das Erdgeschoss war wie die Goslarer Pfalz durch eine
Fußbodenheizung heizbar. Die Burg und große Teile der
Altstadt
wurden 1252 durch einen Brand zerstört. Der an gleicher Stelle
errichtete Neubau wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals
umgestaltet. Der heutige Palas wurde von 1887 bis 1906 auf der
Grundlage intensiver archäologischer Untersuchungen auf Kosten des
Regenten Prinz Albrecht rekonstruiert und im neoromanischen Baustil
wieder erbaut. Auf dem Burgplatz steht die Nachbildung des
Braunschweiger Löwen (Foto rechts). Videoclip mit Glockengeläut des
Braunschweiger Domes.
|
 |
 |

|
Über
eine Treppe gelangt man in den
ersten Stock des
zweigeschossigen, 15 × 42 Metern großen Saalbaus., wo sich
der....
|
|

|

|
....Eingang
(Foto links) zum - in äußerst freier Rekonstruktion
entworfenen - Rittersaal befindet. Das Relief über der Tür
zeigt den
von einem Löwen begleiteten Drachentöter (Foto rechts).
|

|

|
| Die
historisierende, an die Wartburg
erinnernde Ausmalung stammt vom Braunschweiger
Hofdekorations- und Kirchenmaler Adolf Quensen. |

|

|
|
In der Kemenate
gegenüber vom
Rittersaal findet im September 2013 die Ausstellung Cäsaren,
Helden und Heilige statt, die ein Teil der Niedersächsische
Landesausstellung 2013 "Roms
vergessener Feldzug - Die Schlacht am Harzhorn" ist. Die
Reste einer älteren bausubstanz wurden besonders exponiert (Foto
rechts).
|

|

|
Im
„Knappensaal“ im Erdgeschoss des Palas ist mit dem
vermutlich 1754 gegründeten Herzog Anton Ulrich-Museum das
älteste
Museum Deutschlands untergebracht. Das Original des im Auftrag
Heinrichs des Löwen AD 1166 im Hof seiner Burg Dankwarderode
aufgestellten bronzenen Löwen (Foto links), bei dem es sich um den
ersten nach der Antike ausgeführten, größeren
freistehenden
figürlichen Hohlguss handelt.
Ein Mantel mit Löwensybolik (Foto
rechts). |
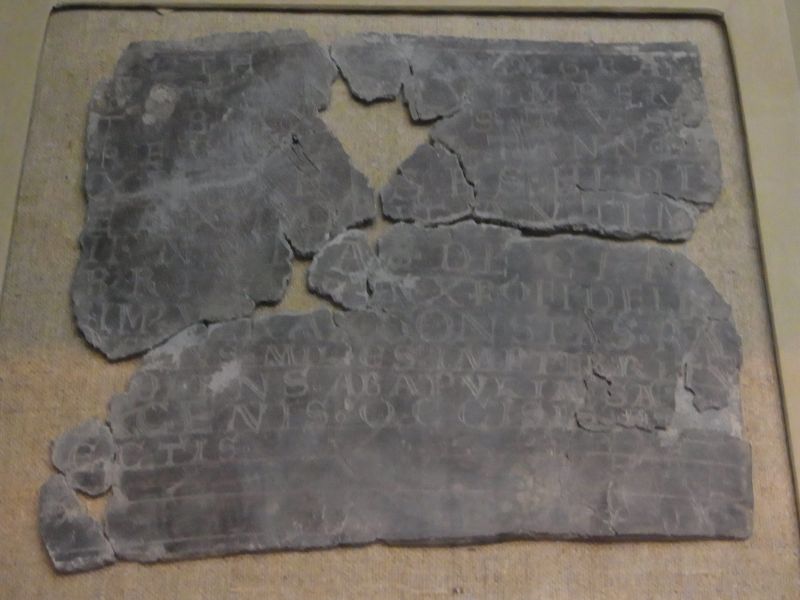
|

|
Schrifttafel
(Foto links) und Reichsapfel (Foto rechts) aus dem Grab Kaisers Lothar III.
von Supplinburg (1075 - 1134).
|

|

|
Avers
(Foto links) und Revers (Foto rechts) einer der sechs Brakteakten
Heinrichs des Löwen.
|

|

|
Holzkästchen
aus dem Welfenschatz, 14./15 Jahrhundert (Foto links). Zwei,
aus Knochen, bzw. Hirschgeweih gefertigte Spielsteine aus dem 11:/12
Jahrhundert (Foto rechts).
|

|

|
| Wie die
Säulenarkade im Untergeschoss gehört auch die zur
Münzstraße weisende Rückwand des Palas (Foto rechts)
mit den romanischen
Fenstern des Rittersaales zur historischen Bausubstanz. Alles andere,
insbesondere die Fassade zum Burgplatz, der achteckige Turm
Rekonstruktionen im
Sinne des Historismus und haben in dieser Form
höchstwahrscheinlich
nicht bestanden. |
|
|

|

|
| Der erste
Bau des Braunschweiger
Schlosses wurde ab 1717 erbaut, jedoch erst 1791 vollendet.
Nach
einem Brand in der Nacht zum 8. September 1830 wurde unter Carl
Theodor Ottmer bis 1841 ein zweiter Bau errichtet, der wiederum durch
schwere Luftangriffe während des Zweiten Weltkrieges so stark
beschädigt wurde, dass er 1960 auf Beschluss des Braunschweiger
Stadtrates abgerissen wurde. Auf der entstandenen Brache wurde in der
Folgezeit der „Schlosspark“ angelegt. Dort, an der einstigen
Residenz der braunschweigischen Herzöge (1753 - 8. November 1918)
wurde im Jahr 2007 ein Neubau fertiggestellt, dessen Fassade
weitgehend dem Ottmer-Bau entspricht, in seinem Inneren jedoch
hauptsächlich das Einkaufszentrum „Schloss-Arkaden“ beherbergt
(Foto links).
Die Braunschweiger Quadriga
(Foto rechts) ist von insgesamt fünf in Deutschland
mit Abstand die größte ist. Die zwischen 2006 und 2008 aus
Siliziumbronze gegossene Gruppe wiegt 25,8 Tonnen und misst an ihrer
höchsten Stelle 9,50 Meter; alleine die Figur der Brunonia, der
allegorischen Schutzpatronin von Herzog Wilhelm, des Herzogtums und
der Stadt Braunschweig, ist 5,30 Meter, die vier Zugpferde sind
jeweils 4,30 Metern hoch. |

|

|
| Im
nördlichen Flügel des Neubaus
wurde das Schlossmuseum eingerichtet, das die Geschichte des
Braunschweiger Residenzschlosses und seiner Bewohner erzählt. Auf
rund 600 Quadratmetern im Erdgeschoss des wiedererrichteten
Residenzschlosses findet sich eine Vielzahl von Originalmöbeln,
Gemälden und kunsthandwerklichen Objekten, die zuvor im
Braunschweigischen Landesmuseum, dem Städtischen Museum und dem
Herzog Anton Ulrich-Museum sowie in Privatsammlungen bewahrt, und
für
das Schlossmuseum zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausstellung
lässt auf diese Weise die Innenausstattung des einst prachtvollen
Welfenschlosses zur Zeit Herzog Wilhelms in der Mitte des 19.
Jahrhunderts wiedererstehen. Nachbildungen des „Spiel- und
Musikzimmers“ der Herzogin Marie von Baden und Herzogs Friedrich
Wilhelm (Foto links) und Arbeitszimmer mit Récamière der
Herzogin
Philippine Charlotte (Foto rechts). |

|

|
| Das
Audienzzimmer (Foto links) und der
Thronsaal mit dem Wappen, welches auch den Leitspruch „Honi soit
qui mal y pense“ zeigt (Foto rechts). |

|

|
| Am 22. Mai 1913 fand im
Braunschweiger Residenzschloss eine Galatafel zu Ehren der Hochzeit von Prinzessin
Victoria
Luise, Tochter Kaiser Wilhelms II., und Ernst August von Hannover
(III.) Herzog von Braunschweig, Herzog zu Braunschweig und
Lüneburg,
Prinz von Hannover (1887 - 1953). Zu den Hochzeitgeschenken
gehörte
eine große Kaminuhr der, ein Geschenk der Lünebuger
Ritterschaft .
Der Handschlag zwischen einem preußischen und welfischen
Rittersoll
die Aussöhnung der beiden Dynastien versinnbildlichen und erinnert
an
die Gründung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, das
von Kaiser Friedrich II. im Jahre 1235 als Reichslehen an Otto das
Kind, einen Enkel Heinrichs des Löwen, verliehen wurde. |

|

|
Das Neue Rathaus der Stadt
Braunschweig, wurde zwischen 1894 und 1900 nach Plänen des
Stadtbaurates Ludwig Winter im Stil der Neogotik direkt neben dem Dom
errichtet (Foto links). Eine Gedenktafel erinnert an deutschen Richter
und
Staatsanwalt Fritz Bauer, der eine maßgebliche Rolle beim
Zustandekommen der Frankfurter Auschwitzprozesse spielte (Foto rechts).
|

|

|
| Die aus
Metall gefertigte
Braunschweiger Elle misst 57,07 cm diente seit dem 16. Jahrhundert ,
möglicherweise schon früher, aber auch den Kunden auf
Braunschweigs
Märkten und bei den in Braunschweig stattfindenden Messen zur
Kontrolle, bzw. um Betrug zu vermeiden. Das gotische Altstadtrathaus
(Foto rechts) ist eines der ältesten erhaltenen Rathäuser
Deutschlands, dessen ältester Teil aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts stammt. |
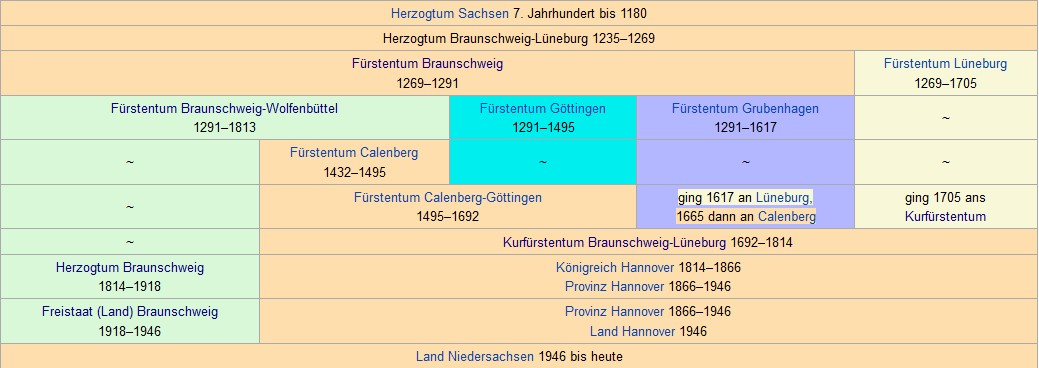
|
Synopse
der staalichen Entwicklung vom Stammesherzogtum Sachsen bis zum
Bundesland Niedersachsen. (Quelle: Wikipedia)
|

|

|
|
Aus dem Herzogtum wurde
ein Freistaat,
der 1946 im neuen Bundesland Niedersachsen aufging (Karte links).
Foto rechts, von links nach rechts: Riemenschnalle und -zunge aus dem
Rhein-Maas-Gebiet,
(1130). Goldener Thebalring und Silberring Lothars III. , beide aus
der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Bleizepter aus dem Grab
Lothars III. (1137). Bleikrone aus dem Grab der Kaiserin Richenza (*
um 1087-89- 1141), der Gattin des Kaisers Lothar III. von Supplinburg
(1075 - 1137).
|

|

|
Das
Herzog Anton Ulrich-Museum (HAUM)
wurde 1927 nach seinem Gründer Anton Ulrich, Herzog von
Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714), benannt Als eines der
ersten Museen in Deutschland, die für die Öffentlichkeit
zugänglich
waren, wurde es ein Jahr nach dem Britischen Museum in London
eröffnet. Die Jadeit-Beilklinge wird auf 4000 v. Chr. datiert und
wurde im Braunschweiger Stadtteil Geitelde gefunden (Foto rechts).
|

|

|
Zur
Dauerausstellung des Museums
gehören auch diese zwei trepanierten Schädel (um
3300 v. Chr.), gefunden in Börnecke,
einem Ortsteil der Stadt Blankenburg (Harz) im Landkreis Harz in
Sachsen-Anhalt (Foto links) und der Hort aus bronzenen
Kurzschwertern (um 2000 v.
Chr.), die in Dettum im Landkreis Wolfenbüttel gefunden wurden
(Foto rechts).
|

|
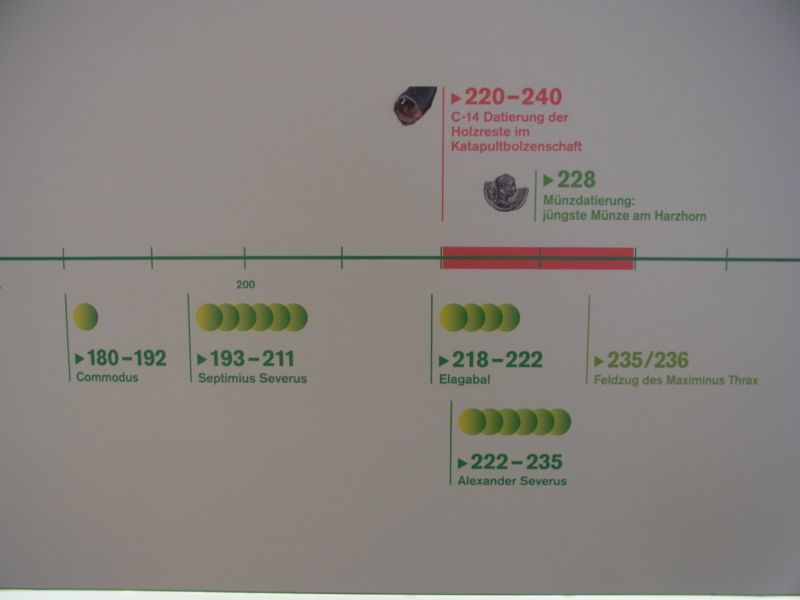
|
| Über
eine Treppe (Foto links) gelangt man in den ersten Stock des HAUM, wo
vom 1.
September 2013 bis zum 19. Januar 2014 die
Niedersächsische
Landesausstellung 2013 "Roms vergessener Feldzug – Die
Schlacht am Harzhorn“ stattfindet. Anhand von Münzfunden wurde
das
„Harzhorn-Ereignis“ in die Regierungszeit des römischen Kaisers
Maximinus Thrax (235/236) datiert (Foto rechts) |

|

|
Religiöse
Skulpturen und rituelle Gegenstände der Römer mit einem Iupiter
Dolichenus (Foto links) und "Germanen" mit Thorshammer und
Göttersymbolen (Foto rechts), wie sie auch im Opfermoor Niederdorla
in Thüringen ausgestellt sind.
|
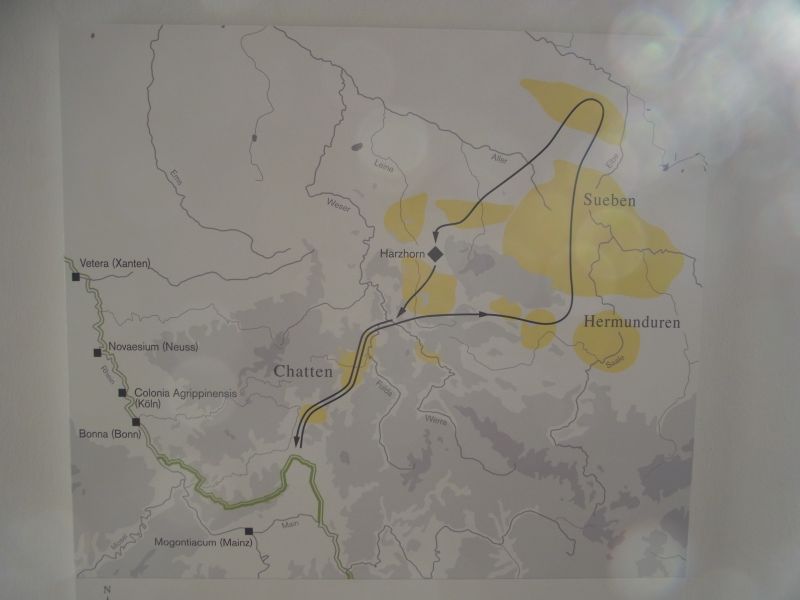
|

|
Die
mutmassliche Marschroute (Foto links) der Truppen des Imperators
Maximinus (172/183 - 238). Büste des Maximinus Thrax (Foto
rechts).
|

|
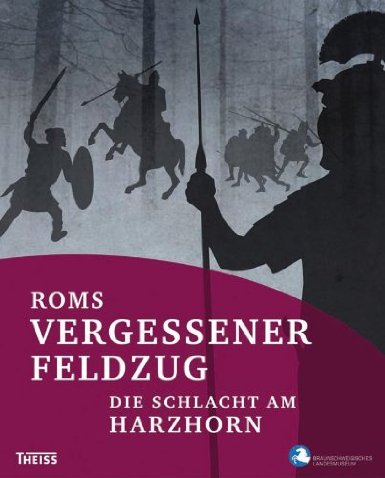
|
Mithras
tötet den Stier im Relief links.
|
timediver®'s
Rezension
für den Begleitband zur Ausstellung
|

|

|

|
| Verbrennungsstuhl
der „Schlüterliese“ Anna Maria Ziegler aus Wolfenbüttel aus
dem
Jahre 1575 (Foto links). Der „Metternich-Orden“
von Herzog Karl
II. Von Braunschweig und Lüneburg, 1825 (Foto Mitte). Die
detailgetreue Rekonstruktion der Alten Waage (Foto recht) in der
Braunschweiger
Neustadt steht vor der Kirche St. Andreas in Braunschweig, die
wahrscheinlich auf einen Saalkirchenbau um das Jahr 1160
zurückgeht. |
|